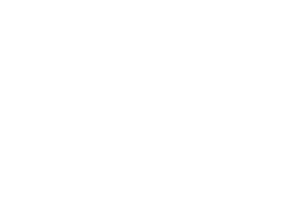Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme bilden das digitale Rückgrat mittelständischer Unternehmen. Denn als zentraler Prozess- und Daten-Hub steuern sie kritische Abläufe von der Auftragsbearbeitung über die Materialwirtschaft bis hin zum Finanzwesen und halten somit den gesamten Betrieb am Laufen. Allerdings sind viele dieser Systeme über Jahrzehnte organisch gewachsen und dementsprechend als monolithische Architekturen konzipiert.
Das starre Korsett gewachsener ERP-Systeme
Ein monolithisches ERP-System ist eine eng gekoppelte, in sich geschlossene Anwendung. Historisch gesehen wurden solche Systeme oft als Insellösungen für einzelne Abteilungen entwickelt und später über manuelle oder fehleranfällige Schnittstellen mit anderen Altsystemen verbunden. Folglich führt diese Struktur zu einer starren, schwerfälligen IT-Landschaft, die den heutigen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gerecht wird. Die moderne Unternehmensführung hingegen erfordert mehr Agilität, Flexibilität und damit die Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.
Um fundierte Modernisierungsstrategien zu entwickeln, ist es unerlässlich, die spezifischen Probleme und strukturellen Schwächen dieser gewachsenen Systemlandschaften zu verstehen. Nur auf dieser Basis können Unternehmen einen zukunftsfähigen Weg einschlagen, der ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichert.
Problemanalyse: Warum monolithische ERPs zur Innovationsbremse werden
Die Identifikation der Schwachstellen veralteter ERP-Systeme ist von strategischer Dringlichkeit, da diese Systeme oft nicht nur ineffizient sind, sondern sich zu einem aktiven Hindernis für Wachstum und Innovation entwickeln. Sie binden wertvolle Ressourcen, verlangsamen Prozesse und verhindern dadurch die Einführung neuer Geschäftsmodelle, was die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens direkt untergräbt. Folglich sind die zentralen Herausforderungen, mit denen sich mittelständische Unternehmen konfrontiert sehen, vielfältig und tiefgreifend.
• Hohe Wartungs- und Betriebskosten: Hohe Wartungskosten stellen für viele Unternehmen eine der größten Herausforderungen dar. Diese Kosten verschlingen oft den Löwenanteil des IT-Budgets, das dann für strategische Innovationen fehlt. Hinzu kommen hohe Supportkosten, die für Altsysteme anfallen, deren Technologie nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht.
• Mangelnde Flexibilität und Agilität: Monolithische Architekturen sind nur schwer an neue Geschäftsanforderungen oder veränderte Marktbedingungen anpassbar. Daher ist der Bedarf an mehr Agilität und Flexibilität ein zentraler Treiber für die Modernisierung. Denn standardisierte 08/15-Prozesse, die von starren Systemen vorgegeben werden, generieren selten echte Mehrwerte oder Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb.
• Veraltete Technologie und Funktionslücken: Viele Altsysteme sind technologisch überholt und bieten dementsprechend nur unzureichende Funktionalitäten. Daher müssen Funktionslücken oft durch manuelle Workarounds oder zusätzliche Insellösungen geschlossen werden, was wiederum die Komplexität und Ineffizienz weiter erhöht.
• Integrationsprobleme und Daten-Silos: Die Verbindung mehrerer unterschiedlicher Systeme über fehleranfällige Schnittstellen führt zum sogenannten „Multiplattform Problem“. Infolgedessen sind Daten nicht durchgängig verfügbar, und es entstehen Inkonsistenzen sowie isolierte Daten-Silos in den einzelnen Abteilungen. Dies wiederum verhindert eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen und erschwert somit datengestützte Entscheidungen.
• Eingeschränkter mobiler Zugriff: Die Möglichkeit, mobil und ortsunabhängig auf ERP-Daten und -Funktionen zuzugreifen, ist darüber hinaus Unternehmen ein Hauptgrund für eine Modernisierung. Traditionellen monolithischen Systemen fehlt diese Fähigkeit oft gänzlich, was die Produktivität, insbesondere von Mitarbeitern im Außendienst oder in der Lagerlogistik, stark einschränkt.
ERP-System vom Bremsklotz zum Innovationstreiber
Trotz dieser gravierenden Nachteile gibt es etablierte strategische Ansätze, um eine Modernisierung erfolgreich zu gestalten und das ERP-System vom Bremsklotz zum Innovationstreiber zu wandeln.
Strategische Lösungswege zur Modernisierung
Für die Modernisierung eines monolithischen ERP-Systems existiert kein universeller Königsweg. Vielmehr hängt die Wahl der richtigen Strategie von individuellen Faktoren wie dem Unternehmenskontext, der vorhandenen IT-Landschaft, der Risikobereitschaft und dem verfügbaren Budget ab. Grundsätzlich lassen sich jedoch drei Hauptstrategien unterscheiden, die Unternehmen zur Verfügung stehen
Inkrementelle Modernisierung durch Dekomposition
Anstatt einer risikoreichen „Big Bang“-Migration, bei der das gesamte System auf einmal ersetzt wird, ermöglicht die inkrementelle Modernisierung eine schrittweise Ablösung des Monolithen. Dies geschieht, weil dieser Ansatz das Projektrisiko erheblich reduziert.
- Das Strangler-Fig-Muster (Würgerfeigenmuster) ist ein bewährter Ansatz für diesen Prozess. Benannt nach der Würgerfeige, die einen Wirtsbaum langsam umschlingt und schließlich ersetzt, werden hierbei einzelne Systemfunktionen schrittweise neu geschrieben und als eigenständige Services ausgelagert. Auf diese Weise wird der Funktionsumfang des Altsystems nach und nach reduziert, bis es am Ende vollständig außer Betrieb genommen werden kann.
- Eine Methode zur Umsetzung dieses Musters ist das „Zerlegen nach Geschäftsfähigkeit“ (Decomposition by Business Capability). Dabei werden neue Microservices entlang etablierter Geschäftsfunktionen wie Vertrieb, Marketing oder Kundenservice entwickelt. Folglich stellt dieser Ansatz sicher, dass die neue Architektur eng am Geschäftsmodell ausgerichtet ist.
Die folgende Tabelle fasst die zentralen Vor- und Nachteile dieses Vorgehens zusammen:
| Vorteile | Nachteile |
| Reduziert das mit großen Migrationen verbundene Risiko. | Erfordert ein tiefes Verständnis des gesamten Geschäfts, um Funktionen korrekt zu identifizieren. |
| Führt zu einer stabilen, zukunftsfähigen Microservices-Architektur. | Erhöhte Komplexität bei der Koordination von Teams und Diensten, insbesondere bei zirkulären Abhängigkeiten zwischen den neuen Microservices. |
| Entwicklungsteams arbeiten funktionsübergreifend und wertorientiert. | Die Abstimmung der Teams auf die exakten Funktionen der Endbenutzer kann sich als schwierig erweisen. |
Umstieg auf Cloud- und SaaS-ERP-Lösungen
Der Trend zur Nutzung von Cloud-basierten ERP-Lösungen ist unverkennbar, wenngleich jedoch eine reine „Alles in die Cloud“-Strategie selten ist. Stattdessen ermöglicht diese hybride Strategie Unternehmen, sich dem Thema Cloud behutsam zu nähern, indem der bestehende On-Premises-ERP-Kern beibehalten und durch neue, flexible Cloud-Funktionen erweitert wird, um somit die Vorteile beider Welten zu kombinieren.
Die Hauptgründe für die Einführung einer Cloud-Strategie :
- Kürzere Implementierungszeit: schnellere Inbetriebnahme im Vergleich zu On-Premises-Installationen ein entscheidender Vorteil.
- Möglichkeit zur Überführung vorhandener Prozesse: Die Option, etablierte und bewährte Prozesse in die Cloud zu überführen
- Reduzierung der IT-Kosten: die Senkung der Betriebs- und Wartungskosten der primäre Treiber.
- Mobiler und ortsunabhängiger Zugriff: Die Möglichkeit, jederzeit und von überall auf Daten und Funktionen zugreifen zu können
Risiken und typische Fallen bei der ERP-Modernisierung
ERP-Einführungsprojekte sind hochkomplex, und daher ist das Risiko einer Fehlimplementierung erheblich. Tatsächlich kann ein Scheitern nicht nur zu Budgetüberschreitungen führen, sondern auch den operativen Betrieb empfindlich stören. Folglich ist ein proaktives und strukturiertes Risikomanagement kein optionaler Zusatz, sondern vielmehr ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Risiken lassen sich dabei in allgemeine Projektrisiken und strategiespezifische Fallstricke unterteilen.
Allgemeine Projektrisiken
Folgende allgemeine Risikobereiche identifizieren:
- Organisatorische Risiken: Hierzu zählen ein Mangel an qualifiziertem Personal für das Projekt oder unvorhergesehene Mitarbeiterengpässe, die den Projektfortschritt gefährden.
- Technische Risiken: Ein typisches technisches Risiko ist die Inkompatibilität des neuen Systems mit der bestehenden IT-Infrastruktur, was zu unvorhergesehenen Integrationsproblemen führen kann.
- Terminliche und kapazitive Risiken: Eine häufige Fehlerquelle ist die Unterschätzung des tatsächlichen Aufwands, was zu erheblichen Projektverzögerungen und Ressourcenengpässen führt.
- Kosten- und Nutzen-Risiken: Budgetüberschreitungen sind ein klassisches Projektrisiko. Ebenso gefährlich ist die Gefahr, dass der erwartete Nutzen der Investition am Ende nicht realisiert wird.
- Menschliche oder psychologische Risiken: Hierzu zählt der Widerstand der Mitarbeiter gegen neue Prozesse, der oft aus Angst vor Veränderung oder mangelnder Einbindung entsteht und den Erfolg des gesamten Projekts untergraben kann.
Strategiespezifische Fallstricke
Je nach gewähltem Modernisierungsweg treten spezifische Herausforderungen auf:
- Bei Cloud/SaaS-ERP: Die Nutzung von standardisierten Cloud-Lösungen birgt das Risiko des Verlusts prozessualer Alleinstellungsmerkmale, die einen Wettbewerbsvorteil darstellen.
- Bei Open-Source-ERP: Der größte Nachteil ist der fehlende Herstellersupport. Dies erfordert ein tiefes internes technisches Verständnis zur Fehlerbehebung und Weiterentwicklung. Zudem besteht das Risiko „versteckter Kosten“, die durch unvorhergesehenen Entwicklungs- und Debugging-Aufwand entstehen können.
- Bei inkrementeller Modernisierung: Eine zentrale Schwierigkeit besteht zunächst darin, die Geschäftsfunktionen für die Zerlegung korrekt zu identifizieren. Außerdem kann die Koordination der Entwicklungsteams komplex werden, insbesondere wenn zirkuläre Abhängigkeiten zwischen den neuen Services bestehen.
Vorgehensmodell in fünf Phasen
Eine erfolgreiche ERP-Einführung erfordert einen strukturierten, phasenweisen Ansatz, um die hohe Komplexität zu beherrschen und damit Fehlimplementierungen zu vermeiden. Daher bietet dieses Fünf-Phasen-Modell einen generischen und praxiserprobten Leitfaden, der Unternehmen dabei unterstützt, den gesamten Projektlebenszyklus von der Vorbereitung bis zum operativen Betrieb zu steuern
1. Projektvorbereitung
◦ Ziel: In dieser initialen Phase werden die Grundlagen für das gesamte Projekt gelegt. Es geht darum, den Rahmen abzustecken, klare Ziele zu definieren und das Fundament für eine erfolgreiche Umsetzung zu schaffen.
◦ Aufgaben:
- Zusammenstellung eines schlagkräftigen Projektteams
- Definition der Projektziele nach dem SMART-Ansatz
- Durchführung eines offiziellen KickOff-Meetings für alle Beteiligten
- Definition der technischen Anforderungen an die Infrastruktur
- Systematische Risikoabschätzung und Erstellung einer Risikomatrix
- Erstellung eines detaillierten Projektzeitplans
2. Business Blueprint
◦ Ziel: Diese Phase ist das Herzstück der Konzeption. Hier werden die Geschäftsprozesse, die im neuen System abgebildet werden sollen, detailliert analysiert und dokumentiert. Das Ergebnis ist eine exakte Spezifikation der Anforderungen.
◦ Aufgaben:
- Prozessanalyse und -definition (Ist-Analyse der bestehenden Abläufe)
- Systemanalyse zur Gestaltung der zukünftigen IT-Landschaft
- Datenanalyse zur Sicherstellung der Datenqualität und Planung der Datenbereinigung
- Detaillierte Anforderungsdefinition und Erstellung des Lastenhefts
- Durchführung einer ersten, fundierten Kostenanalyse
3. Umsetzung (Realisierung)
◦ Ziel: Das System wird technisch implementiert, konfiguriert und an die im Business Blueprint definierten, unternehmensspezifischen Anforderungen angepasst.
◦ Aufgaben:
- Erstellung des Designs der Implementierung (technisches Pflichtenheft)
- Anpassung des Systems durch Entwicklung und Customizing
- Parallele Installation und Konfiguration des späteren Echtsystems
- Implementierung eines umfassenden Sicherheitskonzepts
- Finale und detaillierte Planung des Go-Live
4. Testphase
◦ Ziel: Die Sicherstellung der Funktionalität, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des neuen Systems unter realitätsnahen Bedingungen, bevor es in den produktiven Einsatz geht.
◦ Aufgaben:
- Durchführung des Testbetriebs mit migrierten Stammdaten
- Organisation eines Probebetriebs (oft als paralleler Betrieb von Alt- und Neu-System zur Fehleridentifikation)
- Planung und Durchführung von umfassenden Mitarbeiterschulungen
5. Operativer Betrieb und Go-Live
◦ Ziel: Das neue System wird produktiv gesetzt (oft als „Big Bang“) und in den laufenden Betrieb überführt. Gleichzeitig werden Prozesse für Wartung und kontinuierliche Verbesserung etabliert.
◦ Aufgaben:
- Durchführung des finalen Go-Live
- Etablierung eines professionellen IT-Servicemanagements (z. B. nach ITIL)
- Organisation von Wartung und Support für den laufenden Betrieb
- Offizieller Projektabschluss und finale Dokumentation
Die konsequente Einhaltung dieses strukturierten Vorgehens ist entscheidend, um die Projektrisiken zu kontrollieren und den Erfolg der Modernisierungsinitiative sicherzustellen.
Strategische Empfehlungen
Die Modernisierung monolithischer ERP-Systeme ist für den Mittelstand weniger eine Frage des „Ob“, sondern vielmehr eine des „Wie“. Tatsächlich ist die Transformation von starren, kostspieligen Altsystemen zu flexiblen, agilen Plattformen unumgänglich, um in einer zunehmend digitalisierten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wie dargelegt, stehen Unternehmen verschiedene strategische Optionen zur Verfügung: einerseits die risikoarme inkrementelle Modernisierung, andererseits der Umstieg auf skalierbare Cloud- und SaaS-Lösungen oder die Implementierung anpassbarer Open-Source-Systeme. Dabei gilt: Die richtige Wahl ist keine rein technische Entscheidung, sondern hängt maßgeblich von den individuellen Unternehmenszielen, der vorhandenen Prozesslandschaft, der Risikotoleranz und den verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen ab.
Abschließend lässt sich festhalten, dass der Erfolg einer ERP-Modernisierung weniger von der gewählten Technologie als vielmehr von einem disziplinierten, phasenweisen Vorgehen abhängt. Ein strukturiertes Modell, wie das hier skizzierte, schafft die notwendige Transparenz und Kontrolle, um ein derart komplexes Projekt zu steuern. Insbesondere einer gründlichen Planungs- und Analysephase (dem Business Blueprint) kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu. Denn nur wenn die Anforderungen und Prozesse von Beginn an klar definiert sind, können Risiken minimiert, Kosten kontrolliert und somit der strategische Nutzen der Investition maximiert werden.
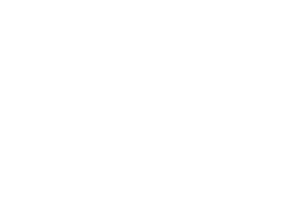
Monolithische ERP-Systeme im Mittelstand: Herausforderungen, Lösungswege und Risikomanagement
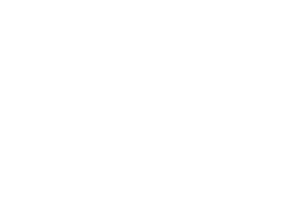
SAP Business ByDesign vs SAP S/4HANA Cloud
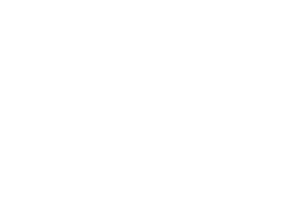
SAP Business One vs SAP Business ByDesign
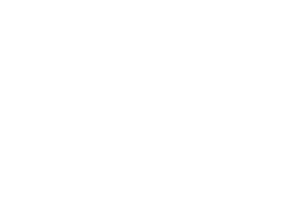
Business Process Reengineering vor ERP Einführung
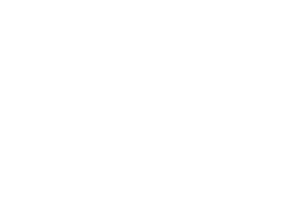
Einführung von Unternehmenssoftware – überraschend nicht technologisch